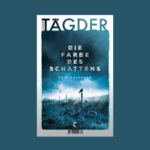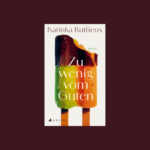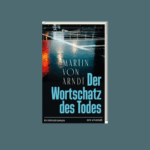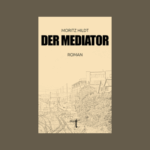Klaus Mann: Mephisto. Roman einer Karriere
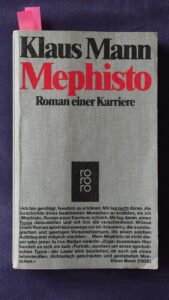 Dieser Roman stand im Lesekreis auf der Rohrer Höhe auf dem Programm, kurz zuvor war er mir auch von anderer Seite empfohlen worden.
Dieser Roman stand im Lesekreis auf der Rohrer Höhe auf dem Programm, kurz zuvor war er mir auch von anderer Seite empfohlen worden.
Dem Roman vorangestellt ist die Bemerkung: „Ich bin genötigt, feierlich zu erklären: Mir lag nicht daran, die Geschichte eines bestimmte Menschen zu erzählen, als ich „Mephisto, Roman einer Karriere“ schrieb. Mir lag daran, einen Typus dazustellen und mit ihm die verschiedenen Milieus…“
Der Sohn von Thomas Mann erzählt in seinem 1936 erschienen Roman die Geschichte des Schauspielers Hendrik Höfgen und dessen Aufstieg zum gefeierten Star und Intendanten des Berliner Staatstheaters. Angesiedelt in den Jahren 1926 bis 1936 schildert Klaus Mann, wie sich der Kommunist Höfgen langsam zu einem Opportunisten unter den neuen Machthabern verwandelt, für den seine Karriere über jeder Ideologie und menschlicher Bindung steht. Er schildert detailliert das Theaterleben und den Aufstieg Höfgens über Stationen in Hamburg, Wien und Berlin und wie es ihm gelingt, mit Hilfe der Geliebten und späteren Ehefrau des Ministerpräsidenten, der Schauspielerin Lotte Lindenthal, dessen Gunst zu erlangen. Entscheidend dabei ist seine Darstellung des Mephisto. In der Pause holt ihn der Ministerpräsident in die Loge und plaudert 25 Minuten mit ihm – der Durchbruch und gleichzeitig ein Pakt mit dem Teufel, wie dieses zentrale Kapitel überschrieben ist.
Ich fand es erstaunlich, wie hellsichtig, ja in manchen Passagen geradezu prophetisch, Klaus Mann nicht nur die Zeit, in denen der Roman spielt, beschreibt, sondern auch die Zukunft, die zu erwarten ist, heraufbeschwört. Ich musste mir immer wieder vergegenwärtigen, dass dieses Buch 1936 erschienen ist. Geschrieben hat es Mann auf Anregung des im Exil lebenden deutschen Autors Hermann Kesten, der Ende 1935 in einem Brief an ihn schrieb: „Um es kurz zu machen, meine ich, Sie sollten den Roman eines homosexuellen Karriereisten im dritten Reich schreiben, und zwar schwebte mir die Figur des von Ihnen künstlerisch… schon bedachten Herrn Staatstheaterintendanten Gründgens vor.“ In nur 6 Monaten schrieb Klaus Mann seinen Roman, der nicht in Deutschland, sondern in Amsterdam erschienen ist. Bis heute ist der Roman übrigens offiziell verboten – ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes wurde nie aufgehoben. In der DDR war das Buch erhältlich, in der Bundesrepublik setzte sich der Rowohlt Verlag Anfang der 80er Jahre über das Verbot hinweg, nachdem in Frankreich gedruckte Raubkopien des Romans auch in deutschen Buchhandlungen verkauft wurden.
Gründgens war der Ex-Schwager von Klaus Mann und beide verband auch eine Zeit gemeinsamer Arbeit am Theater in Hamburg. Die Ehe zwischen Erika Mann und Gründgens hielt nur 3 Jahre, aber natürlich kannte Klaus Mann Gründgens gut und das merkt man, trotz aller Beteuerungen, dem Roman an. Auch wenn ich mich erst in die Sprache, die manchmal etwas altertümlich anmutet, einfinden musste, habe ich das Buch mit zunehmender Faszination gelesen. Vor allem die Parallelen der Zeit, die Mann beschreibt, zu unserer Zeit jetzt sind teilweise erschreckend. Manche Dialoge werden fast wortgleich heute wieder geführt, wenn es um den Umgang mit rechtspoulistischen Parteien wie der AFD geht. Eindrücklich war mir auch eine kurze Passage, in der aufgezählt wird, welche klassischen Bühnenwerke irgendwann nicht mehr aufgeführt werden durften und wie Hoefgen dann auf bedeutungslose uralte Klamotten zurückgegriffen hat. Insgesamt also eine hochinteressante, bereichernde Lektüre!
Das Buch ist in verschiedenen Ausgaben lieferbar, sie können es im Vaihinger Buchladen bestellen oder herunterladen. Ich habe es in der Ausgabe des Rowohlt Taschenbuch Verlages von 1981 gelesen, die bei uns im Bücherschrank stand.
Eine Leseprobe finden Sie hier
Natürlich ist dieser Roman auch ein Schlüsselroman – bei der Lektüre kann man sich auch darin verlieren, zu versuchen herauszufinden, welche Figur im Roman welcher historischen Persönlichkeit entsprechen könnte. Das macht die Lektüre aber auch mühsamer, weil man ständig zum Smartphone greifen muss. Ich habe es deshalb irgendwann aufgegeben – die wesentlichen Figuren sind sowieso schnell identifiziert und für mich war es nicht das spannendste bei der Lektüre. Es gibt jedoch diese Seite „Klaus Manns Schlüsselroman Mephisto entschlüsselt“, die die Figuren und Ereignisse gegenüber stellt. Ich habe sie erst nach der Lektüre entdeckt – möge sie Ihnen Recherchemühe ersparen.