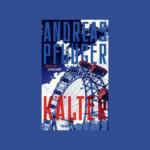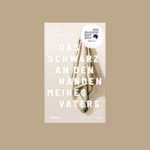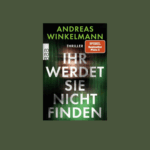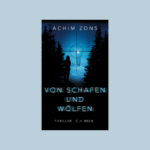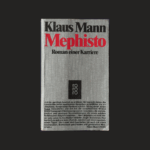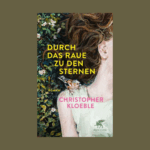„Das Schwarz an den Händen meines Vaters“. Lesung mit Lena Schätte in der Stadtbibliothek Stuttgart
Der Roman „Das Schwarz an den Händen meines Vaters“ der aktuellen Stipendiatin des Stuttgarter Schriftstellerhauses Lena Schätte hatte mich beeindruckt und so freute ich mich, dass ich sie in der Stuttgarter Stadtbibliothek bei ihrer Lesung im Café Lesbar live erleben konnte. Im Gespräch mit der Programmleiterin des Schriftstellerhauses Viola Völlm erfuhr das interessierte Publikum nicht nur einiges über das Buch, sondern auch darüber, wie Lena Schätte schreibt.
In ihrem Roman spürte ich schon beim Lesen, dass das Thema Alkohol und Sucht eines ist, das der Autorin nahe ist. Das bestätigte sie im Gespräch: Im Bezug auf Setting einer Arbeiterfamilie im Ruhrgebiet und das Suchtthema ist er zwar autofiktional, aber mit literarisch geformten Figuren handelt es sich dennoch um Literatur.
Recherchieren musste sie für ihren Roman nicht, denn ihr Brotjob als Krankenschwester im Suchtbereich konfrontiert sie täglich mit dem Leben von Familien, in denen Alkoholkrankheit oder andere Suchtkrankheiten präsent sind. Sie erlebt die Co-Abhängigkeit der Frauen, die die Familien zusammenhalten, wie vieles mit Humor zugedeckt wird, weil das leichter ist, als Angst und Scham in Worte zu kleiden. Wichtig war ihr vor allem davon zu erzählen, was Alkoholsucht mit den Familien macht, besonders den Kindern, die mit Enttäuschungen, Stigmatisierung und Diskriminierung zurechtkommen müssen – kurz, sie will einen differenzierten Blick werfen auf ein Thema, das in der Literatur meist nur sehr einseitig bearbeitet wird. Denn statistisch gesehen landen Kinder aus Suchtfamilien oft wieder in Suchbeziehungen. Sie sind schon früh destabilisiert und suchen sich wie Motte in ihrem Roman als Erwachsene instinktiv ähnliche Verhältnisse, in denen sie die erlernten Strategien anwenden können.
Schreiben tut Lena Schätte nicht am Edelholzschreibtisch und zu bestimmten Zeiten, sondern extrem chaotisch: Im Auto, in der Bahn, im Café. Sie hört gerne Menschen zu und schreibt sich auf was diese zueinander sagen. Sie führt stets ein Notizbuch bei sich oder spricht Eindrücke ins Handy.
„Ich musste zuerst alles falsch machen, um zu verstehen, wie es für mich geht.“ sagte sie. Während ihres Studiums des literarischen Schreibens am Deutschen Literaturinstitut Leipzig versuchte sie sich in allen möglichen Schreibstilen, bevor sie merkte, dass das reduzierte Schreiben ohne jedes „Sprachgefuchtel“ das ist, was zu ihr passt. „Das Schwarz an den Händen meines Vaters“ war zunächst nur eine Fingerübung, in dem sie sich alles erlaubte, was sie sich sonst nicht erlaubt hatte. Wenn sie beginnt zu schreiben, kommt der Text. Vorher sammelt sie Schnipsel, hört auf Randgeräusche und lässt das alles, wie sie sagt, innerlich köcheln. In dem Moment, in dem dann alles gar ist, fließt es heraus und der Text ist da.
Die Leseabschnitte ergänzten das Gespräch gut und das Publikum lernte eine ganz besondere Autorin kennen, der der Literaturbetrieb eher fern ist und die auf lange Sicht wieder in ihrem Beruf arbeiten will, ganz einfach, weil er sie erdet. Über das Projekt, an dem sie hier in Stuttgart arbeitet, verriet sie nichts, außer – mit einem verschmitzten Grinsen – dass es wieder ein Buch wird. Sicher bin nicht nur ich gespannt, was ihre Leserschaft erwarten wird!